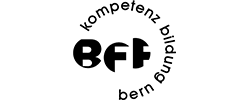Die professionellen Fachkompetenzen der Kindheitspädagoginnen und Kindheitspädagogen HF werden noch immer unterschätzt.
Text und Interview: Janine Oggier
.
Am 14. Juni zogen 8 Kindheitspädagoginnen der 3-jährigen berufsbegleitenden HF-Klasse am Mittag los, um mit vielen anderen Menschen am feministischen Streik in Bern teilzunehmen. Am Morgen wurden aus diesem aktuellen Anlass im Unterricht die Themen Gender, Diversität und vorurteilsbewusste Erziehung gemeinsam vertieft. Danach erarbeiteten die Studierenden die spezifischen Kompetenzen der Kindheitspädagogik und ihre Argumente und Forderungen in Bezug auf ihre gesellschaftliche Anerkennung und entsprechende Entlohnung. Und dann gingen sie zum Streik, um sich zu solidarisieren und um unter anderem auch auf ihre Arbeitssituation aufmerksam zu machen.

Bereits seit 43 Jahren engagiert sich die BFF Bern in der Ausbildung des Fachpersonals für familienergänzende Kinderbetreuung. Von 1980 bis 2005 wurden hier Kleinkindererzieherinnen ausgebildet. 2010 begann der erste Ausbildungsgang der Kindererziehung HF im Vollzeitstudium, und im August 2011 der erste praxisbegleitende Studiengang. Diese tertiäre Ausbildung widmet sich dem Spektrum Kindheit und Jugend, also dem Alter von 0-16 Jahren, und das Grundstudium ist identisch mit demjenigen der Sozialpädagogik HF. Mit der Einführung des neuen Rahmenlehrplans 2022 hat sich die Berufsbezeichnung geändert; nun spricht man von der Kindheitspädagogik HF.
Eine der acht Studentinnen ist Marion Tobler. Nach einem 2-jährigen Vorpraktikum machte sie ihre Lehre zur FaBe-K, also Fachfrau Betreuung mit Fachrichtung Kind, in einer Kita und an der BFF Bern. Nach Abschluss ihres EFZ verliess sie ihren Ausbildungsbetrieb und wechselte zu ihrer heutigen Arbeitgeberin, der Kinderkrippe der Uni Freiburg. Bevor sie im August 2021 das Studium Kindheitserziehung/Kindheitspädagogik HF begann, machte sie die Ausbildung zur Berufsbildnerin. Nun arbeitet sie zu 60% einerseits mit den Kindern und Eltern und bildet eine Lernende aus, und andererseits ist sie im partizipativen Gruppenleitungsmodell verantwortlich für verschiedene Ressortaufgaben.
.

Frau Tobler, warum haben Sie am feministischen Streik teilgenommen und mit welchen Forderungen und Slogans konnten Sie sich identifizieren?
Ich nahm einerseits aus persönlichen Gründen teil. Die Gleichberechtigung und Sichtbarkeit der Bedürfnisse aller Menschen – und eben nicht nur meiner als weisse cis Frau – ist für mich ein grosses Anliegen. Andererseits nahm ich auch für unsere Berufsgruppe teil. Der Slogan «immer no hässig» trifft auch mein Empfinden. Klatschen, wie für das Pflegepersonal, und auch das regelmässige Dankeschön der Eltern sind bestärkende Zeichen, aber sie reichen nicht aus. Es braucht die Sichtbarkeit und Anerkennung der gesellschaftlichen Leistung und Relevanz. Wenn ich erzähle, dass ich in einer Kita arbeite, dann ist oft noch immer die Reaktion darauf: «Ach wie süss!» «Oh, dann kannst du ja den ganzen Tag mit ihnen spielen!» «Ja, es ist ja wichtig, dass die Kinder gehütet werden, während die Eltern arbeiten!» Dabei ist die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindergruppen und Jugendlichen eine anspruchs- und verantwortungsvolle Arbeit, die viel Wissen und Fachkompetenz voraussetzt. Das immer wieder aufs Neue erklären zu müssen, ist sehr frustrierend für mich.
Und auch auf politischer Ebene muss noch einiges mehr geschehen. Es braucht – um einen weiteren Slogan zu zitieren – Lohn, Zeit und Respekt! Die Politik scheffelt noch immer Geld an Orte, wo es nicht mehr gebraucht wird, und wir stehen mit leeren Taschen da.
Was hat Sie dazu motiviert, das HF-Studium zu beginnen?
Ich besitze einen grossen Wissensdurst und auch den Ehrgeiz, meinen Lernenden differenzierte und fachliche Antworten auf ihre Fragen geben zu können. Ich liebe meine Tätigkeit in der Kinderkrippe, aber es war auch schon immer einer meiner Lebenspläne zu studieren. Da bot sich das Studium zur Kindheitspädagogin an, weswegen ich mich dann trotz meiner Prüfungsangst angemeldet habe.
Sie schliessen nun gerade das zweite der drei Studienjahre ab. Welche konkrete Entwicklung nehmen Sie bei sich selbst wahr?
Mich haben die ganzen Theorien, z.B. die Entwicklungspsychologie, schon in der Lehre sehr interessiert. Nun das Ganze nochmals vertieft aufzurollen und mit weiterem Fachwissen zu ergänzen, empfinde ich als extrem bereichernd. Ausserdem bin ich älter und erfahrener geworden. Jetzt im HF-Studium bin ich ganz anders in der Lage, die Dinge zu verknüpfen, zu hinterfragen und zu reflektieren. Mithilfe der vielen Inhalte des Unterrichts und auch der unterschiedlichen Perspektiven der Dozierenden konnte ich eine konkrete und differenzierte pädagogische Haltung entwickeln, und dieser Prozess läuft ja noch weiter. Aber bereits jetzt stelle ich bei mir fest, dass ich dadurch über eine ganz andere Sicherheit verfüge. Ich nehme meine höhere Fachkompetenz selbst wahr und kann sie auch besser gegenüber Eltern und Behörden darstellen. Kürzlich merkte ich, dass ich genau so auf eine Frage der Lernenden antworten konnte, wie ich mir dies erhofft hatte. Das war ein grosses Erfolgserlebnis für mich. Und in meiner Projekt-/Konzeptarbeit entwickelte ich eine Weiterbildung für Lernende zur Thematik Feinfühligkeit. Vor dem Studium hätte ich mir so etwas niemals zugetraut.
Das dritte Studienjahr steht vor der Tür. Was nehmen Sie sich vor, und worauf freuen Sie sich?
Ich freue mich auf die zweite Diplomarbeit, das Prüfungsportfolio. Ich schätze die Gelegenheit und Aufforderung im Schreiben meine Haltung nochmals zu festigen. Ich freue mich darauf, nach dem Verfassen etwas in Händen zu halten, von dem ich sagen kann, dass es die Essenz meines pädagogischen Ichs sichtbar und greifbar macht. Ausserdem bin ich gespannt auf die kommenden Module. Und ja, ich werde weiterhin auch auf meine Work-Life-Balance achten müssen. Mit meinem Engagement, meinen hohen Selbstansprüchen und meiner Begeisterungsfähigkeit ist es nicht immer einfach, die verschiedenen Rollen in der Arbeit, meinem Studium und Privatleben zu vereinen.
Welche beruflichen Pläne haben Sie nach der Diplomierung?
Ich werde vorerst sicherlich im Betrieb bleiben. Ich möchte dort aber mehr Verantwortung, die meinem erworbenen Wissensstand und meinen Kompetenzen entsprechen, übernehmen. Ich könnte mir auch vorstellen, in Richtung Berufsschullehrerin zu gehen. Ich merke, dass mir nach dem Studium viele neue Türen offenstehen werden, die ich jetzt aber noch gar nicht alle erfassen kann.
Welche Kernkompetenzen sehen Sie bei der Kindheitspädagogik HF?
Während das Studium der Sozialpädagogik mit einem extrem breiten Spektrum an Klientel eher eine generalistische Ausrichtung hat, sind wir spezialisiert auf die gesamte Kindheit. Unsere Interaktionen und Interventionen beruhen auf systematischen Beobachtungen, die wir mit dem spezifischen Fachwissen verknüpfen.
.
.

Obwohl seit 13 Jahren das Studium Kindheitserziehung/Kindheitspädagogik HF existiert, wird diese spezialisierte Professionalität noch immer nicht wahrgenommen. Die Kindheitspädagogen und Kindheitspädagoginnen HF verfügen über spezialisiertes Wissen über die gesamte Kindheit bis 16 Jahren, über die Anforderungen der Erziehung, Betreuung und Ermöglichung lebensrelevanter Bildungsprozesse. Sie verfügen über die Fähigkeiten, die Dynamiken in Kinder- und Jugendgruppen zu beurteilen und zu leiten. Sie unterstützen Kinder in ko-konstruktiver Kommunikation bei der Entdeckung ihrer Welt und die Jugendlichen bei den Interpretationen und der Steuerung ihrer Emotionalität und Beziehungsfähigkeit und damit auch bei der Entwicklung ihrer Persönlichkeit. Sie verfügen über spezifische Methoden der Unterstützung bei Schwierigkeiten und Herausforderungen des kindlichen und jugendspezifischen Verhaltens und bei Entwicklungsstörungen. Sie beraten Eltern und Angehörige in den unterschiedlichsten Settings, vom Tür-und-Angel-Austausch über das Elterngespräch bis zur Krisenintervention. Sie gestalten und setzen Ordnungs- und Orientierungssysteme, Raum und Umgebung pädagogisch ein und verfügen über ein wissenschaftsbasiertes und modernes Bildungsverständnis, welches zukunftsweisend ist.
Es ist an der Zeit, dass das Arbeitsfeld der Sozialen Arbeit und die Gesellschaft dies endlich wahrnimmt und in Form entsprechender Arbeitsbedingungen anerkennt. Der dadurch entstehende Mehrwert und der Nutzen sind nämlich gegenseitig.
.